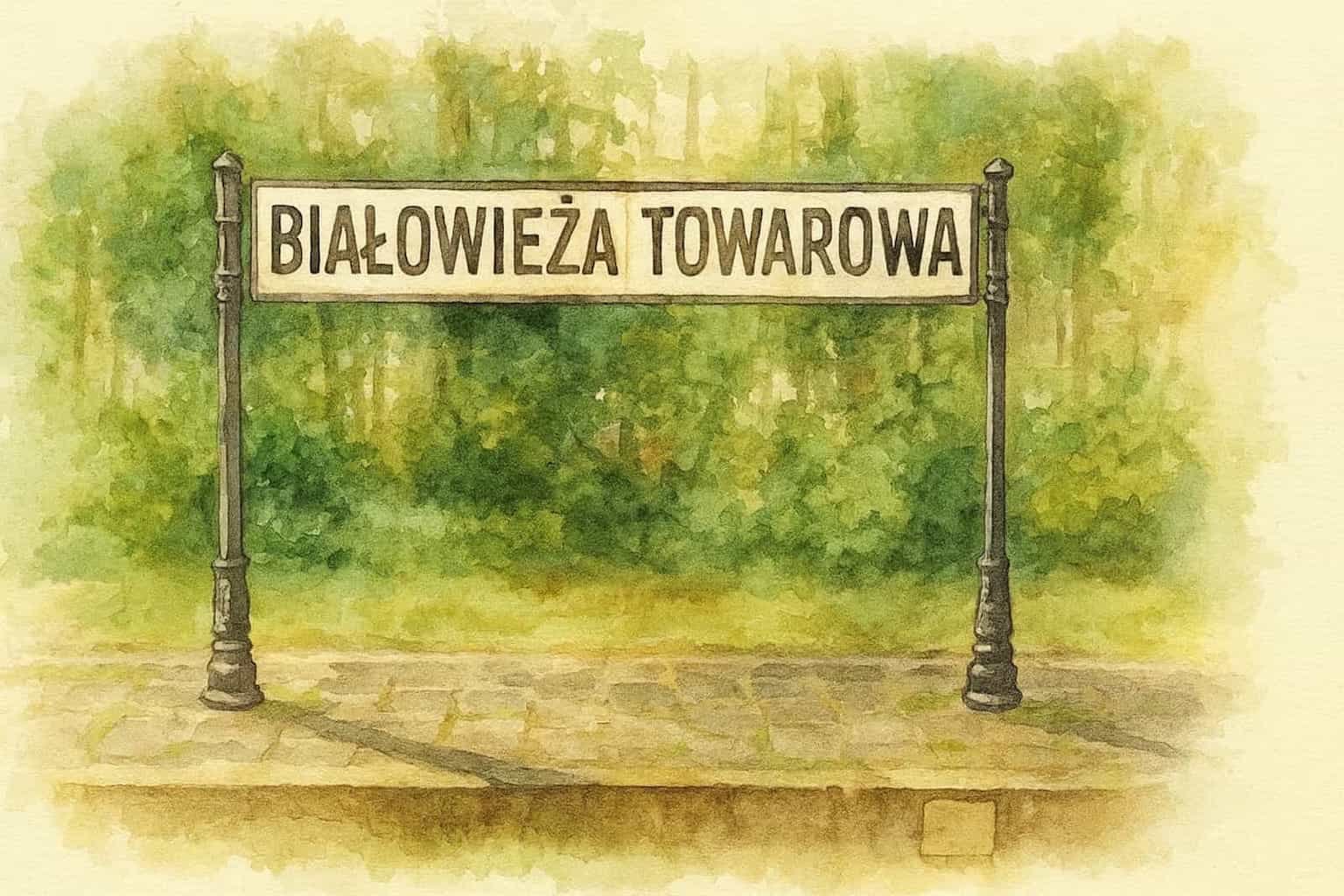Von Fulda nach Suwałki – Angstkorridore im Grünen.
Von Vilnius kommend überqueren wir die litauisch-polnische Grenze – und zum ersten Mal seit fast 10.000 Kilometern durch Nordeuropa werden wir kontrolliert. Die polnischen Grenzer werfen einen Blick ins Wohnmobil, vor allem in die Duschkabine: Man sucht nach Personen, die auf diese Weise über die Grenze geschmuggelt werden könnten. Zum Glück haben wir die Dusche nur zum Duschen benutzt. Für uns ist es die erste ordentlich abgesicherte Grenze auf dieser langen Reise – und wir denken: Die Polen machen es richtig.
Wir sind auf unserer Fahrt über die polnische Grenze nicht auf der Via Baltica unterwegs, sondern auf kleinen Landstraßen, vorbei an Dörfern mit wunderschönen Holzhäusern, die von einer stillen, ländlichen Ordnung erzählen.
Und doch tragen wir unweigerlich einen geopolitischen Begriff im Gepäck: die Suwalki-Lücke. In sicherheitspolitischen Papieren gilt dieser nur 65 Kilometer breite Landstrich als verwundbarstes Stück NATO-Territorium: links das russische Kaliningrad, rechts Belarus, dazwischen die einzige Landverbindung ins Baltikum. Strategen malen sich aus, was im Krisenfall passieren könnte.
Vor Ort jedoch präsentiert sich ein anderes Bild. Wir sehen Felder, Wälder, Seen – eine Region, die eher zum Verweilen einlädt als zu militärischen Planspielen. Die Grenze selbst wirkt unspektakulär: ein Schild, eine Kontrolle, dann geht es weiter.
Diese Diskrepanz zwischen Landkarte und Landschaft erinnert mich an meine Kindheit im Fulda Gap. Auch dort hieß es jahrzehntelang, hier würden im Ernstfall sowjetische Panzer gen Westen rollen. Fulda wurde zu einem Synonym für Angst und Szenarien des Kalten Krieges – während die Menschen inmitten von Barockstadt und Rhön einfach ihren Alltag lebten.
Heute trägt die Suwałki-Lücke dieselbe Last der Projektionen. Militärs denken in Korridoren und Flaschenhälsen, Reisende sehen Dörfer mit geschnitzten Holzbalkonen und friedliche Landschaften. Vielleicht liegt darin eine stille Lehre: dass Orte, die auf den Karten wie Brandherde aussehen, im Erleben nichts anderes sind als Räume voller Normalität – und dass die Angst in den Köpfen oft lauter ist als das, was die Augen wahrnehmen.
Das Kloster Wigry – zwischen See und Stille.
Auf dem Weg durch den Nordosten Polens sind wir im Wigry-Nationalpark gelandet – eine Landschaft, die ganz anders wirkt als die bekannten Masuren\: sanfte Moränenhügel, endlose Wälder, Moore und stille Seen, die wie verstreute Spiegel in der Landschaft liegen. Mitten darin erhebt sich auf einer Halbinsel im Wigry-See das alte Kloster Wigry.
Wir haben schon viele Kirchen und Klöster gesehen, aber das Kloster Wigry war trotzdem ein kleines Highlight. Es liegt auf einer Halbinsel mitten im Wigry-See, und schon wenn man über die schmale Straße dorthin fährt, hat man das Gefühl, auf eine Insel hinauszugleiten und am Ende des Weges thront die barocke Klosteranlage in strahlendem weiß und rose.
Das Gelände wirkt fast wie eine kleine Festung – Mauern, Tore, Innenhöfe. Früher lebten hier Kamaldulensermönche (ein Schweigeorden der Benediktiner), heute sind die alten Zellen als schlichte Gästezimmer eingerichtet. Wir haben uns durch die Räume treiben lassen, über alte Treppen, hinaus auf die Aussichtsterrassen.
Johannes Paul II., der in Polen noch heute allgegenwärtig ist, verbrachte hier 1999, bereits schwer vom Parkinson gezeichnet, einige Tage, in einem extra hergerichteten Appartment, das man heute besuchen kann. Im Museumsteil hängen Fotos und Erinnerungsstücke, die an diesen Besuch erinnern – und man merkt, dass das Kloster für viele Polen ein besonderer Ort ist.
Drumherum beginnt der Wigry-Nationalpark: Wälder, Sümpfe, Wasserflächen, die im Abendlicht golden schimmern. Auf den Wegen begegnet man Radfahrern, Wanderern, und mit etwas Glück auch einem Biber oder Kranich.
Für uns war Wigry nicht nur ein Stück Geschichte, sondern auch ein Moment zum Runterkommen. Ein Ort, der gleichzeitig erhaben und ganz nahbar wirkt – perfekt, um die Reisegeschwindigkeit zu drosseln und einfach mal zu schauen, wie das Licht über den See zieht.
Unter Wölfen. Oder auch nicht.
Dank park4night haben wir einen Stellplatz ca. 30 km nördlich von Białystok gefunden – mitten in einer kaum besiedelten, flachen Landschaft. Wir stehen hier am Rand des Biebrza-Nationalparks, einer weiten Landschaft aus malerischen, wilden Wiesen und dem Fluss Biebrza, der sich mit dem Augustów-Kanal verbindet. Ein Stück ungezähmte Natur, das einem das Gefühl gibt, wirklich weit weg von allem zu sein.
Direkt neben uns steht ein Aussichtsturm, von dem aus man Elche beobachten kann – für meine Höhenangst leider zu hoch. Nachts soll man die Wölfe heulen hören können und als erstes begegnet Sabine bei ihrem Gang aufs Klo einer ausgewachsenen Kreuzotter (wir vermuten, dass es eine Kreuzotter war). Natur pur. Wölfe haben wir übrigens nicht gehört und Elche auch nicht entdeckt. Aber ein paar Kühe auf der Weide vor uns...
Wisente in Białowieża
Wenn man aus Litauen kommend über die kleinen Straßen nach Osten fährt, wird der Wald dichter, ursprünglicher, fast unberührt. Im Białowieża-Urwald fühlt man sich, als hätte die Zeit hier eine Pause eingelegt. Jahrhundertealte Eichen stehen wie Säulen in einem grünen Dom, zwischen ihnen sumpfige Wiesen, in denen Nebelschwaden hängen.
Und irgendwo dort draußen, schwer zu sehen, noch schwerer zu finden, leben sie\: die Wisente, die letzten europäischen Bisons. Bis zu 900 Kilo schwer, mit dunklen, zottigen Mähnen, wirken sie wie Wesen aus einer anderen Zeit – Überbleibsel einer Welt, in der Menschen noch kaum Spuren hinterlassen hatten.
Was uns heute so majestätisch erscheint, war einmal beinahe verloren. Nach dem Ersten Weltkrieg galt der Wisent in freier Wildbahn als ausgerottet. Nur ein paar Tiere hatten in Zoos überlebt. Aus dieser winzigen Restpopulation starteten Forscher in den 1920er-Jahren das Wagnis einer Wiederansiedlung. Dass heute wieder rund 800 Tiere frei im Białowieża-Urwald leben, ist ein kleines Wunder – und ein Beweis dafür, dass Naturschutz mehr sein kann als ein gutes Gefühl.
Wir selbst haben die Tiere nicht einfach am Wegesrand gesehen. Dafür sind sie zu scheu, zu sehr eins mit dem Wald. Aber die Vorstellung, dass irgendwo zwischen den moosbewachsenen Baumriesen eine Herde langsam durch das Unterholz zieht, verleiht diesem Ort eine besondere Spannung. Wer sie wirklich erleben will, bucht am besten eine geführte Safari – am frühen Morgen oder im Winter, wenn die Wisente an Futterstellen treten.
Für uns war allein das Wissen um ihre Gegenwart schon bewegend. Zu wissen, dass hier, in diesem letzten Urwald Europas, ein Stück verlorene Wildnis zurückgekehrt ist. Dass der Wald nicht nur Geschichten von vergangenen Jahrhunderten erzählt, sondern auch von einer zweiten Chance für das Leben.
Reise durchs Land
Von Białowieża aus führt uns der Weg weiter nach Süden, südlich in gebührendem Abstand vorbei an Warschau, durch weite, sanft gewellte Landschaften. Polen zeigt sich hier als echtes Agrarland: Felder, so weit das Auge reicht, kleine Dörfer mit bunt bemalten Holzhäusern, und an fast jeder Kreuzung ein Kruzifix oder eine Marienfigur, geschmückt mit Blumen und bunten Tüchern. Die Religiosität, die man hier spürt, hat eine Selbstverständlichkeit, die man in Deutschland kaum noch kennt – an Sonntagen sind die Kirchen voll, die Menschen tragen ihre besten Kleider. Dazu gleich noch mehr...
In Hajnówka wollen wir die berühmte orthodoxe Kirche Sobór Świętej Trójcy besuchen. Sie wurde in den 1980er-Jahren in einem markanten modernen Stil erbaut: eine kühne Betonkonstruktion mit geschwungenen Linien, die an einen Wald aus Baumstämmen erinnern soll. Ihr Inneres ist für seine Ikonenwand und die außergewöhnliche Akustik bekannt – jedes Jahr findet hier das „Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej“ statt, ein internationales Festival geistlicher orthodoxer Musik. Leider bleiben die Türen bei unserem Besuch verschlossen, wir können noch nicht einmal durch die großen Glasflächen ins Innere spähen. Schade.
Unsere Fahrt führt weiter über Drohiczyn, das malerisch auf einem Hügel über der Bug-Schleife thront. Einst war die kleine Stadt die Hauptstadt des historischen Herzogtums Podlachien. Heute wirkt sie beschaulich, fast verschlafen, mit schönen Ausblicken über die Landschaft.
Schließlich erreichen wir Puławy. Die Stadt trägt den stolzen Beinamen "polnisches Athen", denn hier schuf die Adelsfamilie Czartoryski im 18. und 19. Jahrhundert ein kulturelles Zentrum. Dichter, Wissenschaftler und Künstler gingen ein und aus, und der klassizistische Palast mit seinen großzügigen Parkanlagen erinnert noch heute an diese Blütezeit. Beim Spaziergang durch die gepflegten Alleen und vorbei an alten Pavillons lässt sich erahnen, warum Puławy einst als geistiges Herz Polens galt – auch wenn die Stadt heute ein eher bescheidenes Provinzzentrum ist.
Das fromme Polen
Was einem in Polen ins Auge springt, ist die Religiosität dieses Landes. Man fährt über Land und überall sieht man Marienfiguren oder geschmückte Kruzifixe. Dabei ist es egal, ob es die klassischen Kreuze sind oder die russisch-orthodoxen.
Sonntags braucht man als Tourist überhaupt nicht versuchen, eine Kirche anzuschauen - dort ist Gottesdienst, auch hier egal ob römisch-katholisch oder orthodox. Wir versuchten zwei Kirchen anzuschauen, die Gottesdienstbesucher stehen bis vor die Kirche. Ein völlig anderes Bild als bei uns.
Ich kenne so etwas aus meiner Heimatregion zwischen Vogelsberg und Rhön. Auch dort waren in den 60ern die Kirchen so voll, dass man keinen Platz mehr bekam. In meinem relativ kleinen Heimatort gab es zwei große katholische Kirch, die eine, eine ziemlich große Kirche, wurde erst in den 60ern geweiht und ich kann mich noch gut an diesen Tag erinnern - das ganze Dorf, die ganze Gegend war auf den Beinen. Mittlerweile wurde die Kirche wieder entweiht - es kommt niemand mehr.
Heute herrscht in den Kirchen unseres Lands gähnende Leere, nur ein paar angeblich ewig gestrige verlieren sich hier. Die wenigstens Kirchen haben noch einen eigenen Pfarrer oder Priester. Was ist in diesen 60 bis 70 Jahren nur mit unserer christlich geprägten Kultur passiert? Wir haben unsere weltanschauliche Identität verloren und damit auch unsere Fähigkeit, uns gegen diejenigen klar zu positionieren, die heute zuhauf an die Pforten unseres Landes klopfen. Ein Volk, dass jahrhundertelang die Kultur der Welt wenigstens prägte, wenn nicht sogar dominierte, ist heute dabei, ein kulturloses Volk zu werden.